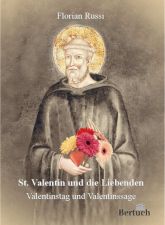Erfahrungen mit der Staatssicherheit der DDR *)
Manfred Meier
Als die alte DDR in den letzten Zügen lag und die Wende der Geschichte unumkehr-bar war, in den Novembertagen von 1989 also, da sagte ein angesehener Berliner Publizist im Gespräch zu mir: Es klinge vielleicht schrecklich, was er da ausspreche, aber eigentlich brauchten wir jetzt so etwas wie die Nürnberger Prozesse in der Nachkriegszeit. Ihm war klar, dass eine ehrliche Aufarbeitung der Verbrechen, die das Regime begangen hatte, mit den bewährten Vertuschungsmethoden der alten Genossen, die ja vorerst noch - auch in der erneuerten Volkskammer eifrig mitrede-ten und agierten, nicht zu schaffen war.
Zu seiner Erheiterung erzählte ich ihm, wie ich nach der großen Demonstration vom 4. November in der Nähe vom Palast der Republik eine Mauerinschrift entdeckt hat-te, die wohl eine Amnestie für Stasimitarbeiter fordern wollte. Bei der offenbar hasti-gen Aktion war dem Schreiber ein bezeichnender Fehler unterlaufen. Sein Text for-derte „Amnesie", also Vergessen - Gedächtnisschwund als politisches Prinzip so-zusagen. So deutlich hatte der Mauerschmierer es sicher nicht aussprechen wollen. Dieses Versehen hätte dem großen Psychoanalytiker Sigmund Freud ohne Zweifel sehr gefallen, er hätte es wohl als typische Fehlleistung in seine Sammlung klassi-scher Fälle aufgenommen.
„Alles vergessen - das könnte denen so passen", sagte ich zu einer Kollegin, die als gute Christin auch ihre Feinde nicht verurteilen mochte. Und sie konterte prompt mit der Frage, ob ich persönlich denn Nachteile durch die Schnüffler, Erpresser und Hä-scher der Staatssicherheit erlitten hätte? Dieser Frage möchte ich hier ein bisschen nachgehen.
Nein, ich bin nie verhaftet oder verschärft verhört worden, die Konfrontationen mit der Behörde waren nicht so direkt erfolgt. Dass über uns als Redakteure sich dauerhaft ein Netz von Observierung spannte, war offensichtlich und bedurfte nicht der Erörte-rung. Es gab in unserem Unternehmen Informanten und Mitarbeiter, die wir längst kannten, es gab einige, die erst nach dem Verschwinden der DDR als solche enttarnt wurden, und wahrscheinlich gab es den einen oder anderen auch, von dem wir es nie erfahren werden. Aber wie viel man in den Archiven über mich gespeichert hatte, deutete mir - als erpresserische Drohung - ein für uns Journalisten zuständiger Mit-arbeiter des Ministeriums in einem als Gespräch bezeichneten Verhör an.
Ich war damals bereits Ressortleiter im Feuilleton, als ein ehemaliger Kollege, der aus uns unverständlichen Gründen plötzlich gekündigt hatte (vielleicht zu unserem Schutz?), der DDR abhanden kam. Er hatte zu irgendeinem runden Geburtstag einer nahen Verwandten nach Österreich reisen dürfen und kam von dort nicht wieder. Und sogleich hatten wir die Schnüffler am Hals. Die Begegnung mit mir hatte der Chefredakteur vermittelt, indem er mich zu einer angeblichen Arbeitsbesprechung bat, dann aber widerte ihn wohl das unwürdige Versteckspiel an und er stellte mir den kultiviert auftretenden Herrn im grauen Flanell kurzerhand als Mitarbeiter der Staatssicherheit vor. Der stutzte darob für einen Moment, fasste sich aber sofort und erklärte mir knallhart zur Eröffnung des Dialogs, wie gut er über mich und meine Be-ziehungen beispielsweise zu Mitarbeitern der Ständigen Vertretung der Bundesrepu-blik Bescheid wüsste. Das hieß mit anderen Worten: Denk bloß nicht, dass du uns täuschen kannst!
Nun vermochte die Drohung mich nicht einzuschüchtern. Die Kontakte zur Ständigen Vertretung, also offizielle Einladungen etwa an den Ressortleiter, mussten ohnehin gemeldet und unsere Zusage vor allem ausdrücklich genehmigt werden. Dass es darüber hinaus weitere Gespräche gab, beispielsweise mit einem mir gut bekannten Journalisten, wussten die Sicherheitsbehörden zweifellos. Auch wenn ich bei einem Besuch mein Auto stets etwas abseits in einer Seitenstraße parkte, war ich mir si-cher, dass die Späher Ankunft und Abfahrt genau notierten. Ich hatte nicht die Ab-sicht und auch keinen Grund, derartige Begegnungen zu leugnen. Dass ich den Stellvertretenden Leiter der Bundesbehörde gut kannte, war den Stasileuten offenbar bekannt. Meinem Vernehmungsoffizier erklärte ich, der Mann sei ein großer Musik-freund, mit dem es sich vortrefflich über viele Themen dieses Genre plaudern ließe. Das entsprach der Wahrheit; was wir sonst noch erörterten, behielt ich freilich für mich.
Aber es ging in dem Verhör ja nicht um mich, sondern um den abtrünnigen Journalis-ten, der bis vor kurzem in unserer Redaktion tätig war. Da zuvor schon andere Kolle-gen zu dem Fall einvernommen worden waren, hatte ich mich informiert, wie viel die Staatssicherheit inzwischen über Kontakte, freundschaftliche oder kollegiale Bezie-hungen wusste. Und so erfuhr der darob sicher ziemlich enttäuschte Herr im grauen Flanell von mir gerade so viel, wie ihm ohnehin schon zugetragen war. Trotzdem - diese Truppe kapitulierte ja nicht - fragte er mich am Ende unseres etwas substanz-armen Dialogs, ob wir uns künftig öfter einmal unterhalten könnten. In irgendeine höf-liche Floskel verpackte ich meine Antwort, dass ich eigentlich nicht wüsste, worüber wir beide miteinander reden sollten. So konnte ich also den Anwerbungsversuch dip-lomatisch zurückweisen - und bin auch später nicht mehr auf eine Mitarbeit ange-sprochen worden. Den Cognac, den mir der Chefredakteur am Beginn der Unterhal-tung anbot, hatte ich ausgeschlagen. Danach aber führte ich mir mehrere zu, um ü-ber die unangenehme Stunde hinwegzukommen.
Jetzt wusste ich also, wie rasch man in die Fänge der Staatssicherheit geraten konn-te. Jene Kollegen, die uns früher oder später als Mitarbeiter dieses SpitzeIunterneh-mens bekannt wurden, ließen sich in drei Grundtypen gliedern. Da gab es den Er-pressbaren, der nicht genügend Mut zum Widerstand aufbrachte und fortan die ge-wünschten Informationen zulieferte. Dann gab es den Widerling, der - wie sich später herausstellte - selbst zur Behörde gelaufen war, um seine Dienste anzubieten. Und schließlich waren da die Unauffälligen, Dienstwilligen, die sich so vorzüglich zu tar-nen verstanden, dass die Überraschung für uns groß war, als die Wahrheit heraus-kam.
Da hatten wir einen Wirtschaftsredakteur, den ich immer für eine Art intellektuellen Spinner gehalten hatte, freundlich, etwas täppisch mitunter, aber von klarem Sach-verstand. Der Mann verschwand eines Tages scheinbar spurlos. Er hatte einen Ter-min wahrnehmen sollen, war am Ziel nicht angekommen, was eine Nachfrage in der Redaktion ergab. Und nun rotierte die Recherche-Maschine. Die Polizei befragte alle Mitarbeiter des Hauses, wann und mit wem sie den Kollegen zuletzt gesehen hätten. Die Befragung geschah so nachdrücklich, als verdächtige man jeden von uns, etwas Wichtiges zu verschweigen. Dann hörten wir nichts mehr von der Sache. Eine junge Frau vertraute mir ihren Albtraum an: Er sei vielleicht erschlagen worden und läge irgendwo im märkischen Sand vergraben.
Wochen später fragte ich beiläufig ein Leitungsmitglied unseres Hauses, ob denn die Untersuchungen Ergebnisse gebracht hätten. Das sollten wir doch erfahren, schließ-lich seien wir alle ja verhört und ein bisschen auch verdächtigt worden. Da sah der mich mitleidig an: Ob ich denn wirklich so naiv sei? Und dann murmelte er etwas von wichtigen Aufgaben zum Schutze unseres Staates, die nun einmal erfüllt werden müssten. Ich war also tatsächlich noch sehr naiv zu dieser Zeit. Sie hatten dem scheinbar Verschwundenen einen neuen Namen verpasst und ihn in geheimer Mis-sion in die Bundesrepublik geschickt.
Eine Zeitlang hatten wir einen Ressortchef, der hauptamtlich für die Staatssicherheit tätig war. Geahnt hatten wir das längst, und es schien, als wolle er das auch gar nicht verheimlichen. Bestätigt bekamen wir es durch einen Zufall. Da rief mich eines Tages ein Mann an, der unseren Musikkritiker sprechen wollte. Er hatte sich mit dem Na-men Richter gemeldet. So hieß der damalige Konzertdramaturg der Staatsoper. Ich zweifelte nicht an dessen Identität und sagte ihm bereitwillig, wann und wo er unse-ren Kritiker erreichen könnte. Am nächsten Tag bezichtigte mich eben jener, ich hätte ihm die Staatssicherheit ins Haus geschickt. Das war für einen anständigen Men-schen damals so ziemlich der übelste Vorwurf, der ihn treffen konnte. Wir rekon-struierten gemeinsam den Vorgang, besagter Herr Richter war Knackpunkt.
Künftig hatte ich öfter einmal diesen Anrufer am Apparat. Er begehrte stets den Res-sortchef zu sprechen, und weil der häufig nicht anwesend war, bat er um Rückruf. Herrn Richter beim Kulturbund möchte er bitte anrufen. Es war der Führungsoffizier des Ressortleiters und Stasimitarbeiters. Eine unerschrockene Redakteurin besaß sogar die Kühnheit, ihm eines Tages als Information einen großen Zettel auf den Schreibtisch zu legen mit dem Hinweis, er möchte „die Sicherheitsnadel im Kultur-bund" anrufen. Es erfolgte keine Reaktion darauf. Unser Ressortchef hatte verstan-den, dass wir verstanden hatten.
Klar bestätigt wurde unser Verdacht, als eben jenem Kollegen, der aus Görlitz nach Berlin übersiedelt war, eine Wohnung im Zentrum zugewiesen wurde: Chaussee-straße 131. Er teilte das geräumige Altberliner Etablissement mit keinem geringern als dem unter ständiger Beobachtung stehenden Staatsfeind Wolf Biermann. Die Wohnung war irgendwann nach dem Kriege geteilt worden, in der anderen Hälfte hatte bisher ein renommierter Schauspieler gewohnt, der mit Beginn des Rentenal-ters in den westlichen Teil Berlins umgezogen war. In höherem Alter durfte man das. Und so wurde die Wohnungshälfte neu vergeben. Ich habe nie die offenbare Ver-trauensseligkeit oder Blauäugigkeit des verfemten Liedermachers Biermann begrif-fen, der doch vermuten musste, dass bei der Neubelegung die ihn bespitzelnde Be-hörde ihre Hand mit im Spiel haben würde.
Vor einiger Zeit ist aus den geschredderten und wieder rekonstruierten Akten der Staatssicherheit der ganze Umfang dieser Observation durch IM Eule oder auch IM Lorenz (so die Decknamen für den „Inoffiziellen Mitarbeiter") belegt worden durch einen Kontrakt mit dem ausdrücklichen Auftrag, „an zersetzenden Maßnahmen ge-gen Biermann mitzuwirken". Solcher Art also waren die „Zielobjekte" unseres Stasi-redakteurs. Wir hatten von ihm offensichtlich wenig zu befürchten und genossen in politisch stürmischen Zeiten wohl eher „Windschutz" dank seiner Beziehungen zur hohen Behörde.
In einer weitaus besser noch windgeschützten Nische ging meine Frau ihrer Arbeit nach: als Katechetin in einer Kirchgemeinde - denn der Religionsunterricht in den Schulen war ja seit langem schon untersagt. Hier waren auch die äußeren Zwänge nicht so zu spüren. Seit die Kirche ihren Frieden mit dem Staat gemacht hatte oder besser: der Staat mit der Kirche - wurden die Schwierigkeiten im Umgang mit der Staatsmacht durch die Kirchenleitungen, durch Bischöfe und Superintendenten ab-gefangen. Bis zur unteren Ebene gelangte der unmittelbare Druck nur selten. Aber dann so nachhaltig, dass alle betroffen erfuhren, in welchem Reservat sie zumeist lebten.
Da organisierte beispielsweise die Junge Gemeinde, die von meiner Frau betreut und angeleitet wurde, regelmäßig Veranstaltungen, zu denen sie die gesamte Gemeinde einlud und die gemeinhin auch sehr gern besucht wurden. Einmal teilten die Jugend-lichen durch Aushang mit, dass sie für den nächsten Abend einen Liedermacher ein-geladen hätten. Nun wurden Liedermacher damals generell vom Staat kritisch be-äugt, weil sie zumeist auch ein paar aufmüpfige Texte vortrugen, wie das ja seit den Zeiten der alten Moritatensänger üblich war. Dieser Liedermacher nun war ein schwerbehinderter junger Mann im Rollstuhl, der nichts als ein bisschen Freude spenden wollte mit seinem wirklich harmlosen, christlich inspirierten Programm. Der Abend verlief harmonisch, am Schluss sangen alle gemeinsam mit dem Amateur-künstler aus dem kirchlichen Gesangbuch.
Nur einer in der Runde hielt sich merklich zurück, er konnte auch die Lieder nicht mitsingen. Dass ihn in der Gemeinde niemand kannte, musste nichts bedeuten, oft genug kamen Außenstehende zu den Abenden, wenn das Thema ihnen interessant erschien. Aber dann wunderten sich manche doch ein bisschen, als das Sammel-körbchen die Runde machte, um das Geld für ein bescheidenes Honorar zusammen zu bekommen. Er ließ den Korb an sich vorbeiwandern, ohne einen kleinen Obolus zu geben. Da wurde mir schlagartig das Groteske der Situation klar: Die Behörde, die ihn entsandt hatte, um die Ohren aufzustellen, hatte ihm keine Spesen mitgegeben. Und da er schließlich keine Quittung für seine Abrechnung verlangen konnte und selbst zu geizig war - vielleicht verdienten ja die kleinen Terrier der großen Stasi auch nicht sonderlich gut - verweigerte er sich. Was zunächst noch eine bloße Ver-mutung blieb, bestätigte sich, als wir uns auf den Heimweg machten. In der engen Straße dieses Altbaugebiets parkten an diesem Abend ganz zufällig mehrere Poli-zeiwagen und andere Fahrzeuge, in denen einige ernst dreinblickende Männer sa-ßen, die offenbar auf einen dramatischen Zwischenfall gewartet hatten. Der harmlose Liedermacher hatte also die Exekutive zu einem Sondereinsatz veranlasst.
In Berlins Kirchen gab es damals übrigens eine Serie von Veranstaltungen, die stets hohe Alarmbereitschaft bei den staatlichen Stellen auslösten: die Bluesmessen. Da wurde zwar eigentlich nur Musik gemacht, aber der Charakter von kleinen Protest-kundgebungen junger Leute war unübersehbar. Und so gehörte es einfach zum Selbstverständnis von Jugendlichen einer bestimmten Altersklasse, daran teilzuneh-men. Noch heute, wenn ich in die Nähe von Gotteshäusern wie der Samariterkirche oder der Erlöserkirche komme, habe ich das Bild vor Augen, wie die umliegenden Straßen von Polizei- und anderen Dienstfahrzeugen belagert waren. In solche schwer bewachten Festungen also wagten sich junge Leute, um ihrem Gemein-schaftsgefühl Ausdruck zu geben.
Auch mein ältester Sohn machte sich eines Abends auf den Weg, um mit Schulka-meraden und Freunden aus der Jungen Gemeinde eine Bluesmesse zu besuchen. Wenig später stand er etwas betrübt wieder vor der Tür. Man habe ihn auf dem Bahnsteig, wo er die Ankunft seiner Freunde erwartet hatte, aufgegriffen und ihm eine Strafanzeige aufgedrückt. Zum Beweis hielt er mir einen leicht verknüllten Zettel hin, auf dem außer einem Stempel und einer unleserlichen Unterschrift nichts zu er-kennen war. Ich solle zehn Mark Strafe für ihn entrichten. Da packte mich die Wut - nicht gegen den Sohn, sondern gegen den Staat. Ich sprang ins Auto und fuhr mit ihm zu jenem Bahnhof nahe der Erlöserkirche.
Das Büro des Stationsvorstehers war von Polizisten in Zivil - also wohl von Stasileu-ten - okkupiert. Als ich ihnen den Zettel unter die Nase hielt und zu erkennen gab, was ich von ihnen und ihren Methoden hielte, wurden sie etwas kleinlaut. Den Straf-zettel habe ein junger unerfahrener Kollege ausgefüllt, und dabei sei ihm offensicht-lich der Fehler unterlaufen, das Durchschlagpapier falsch einzulegen. Nun verlangte ich erst einmal, das Original zu sehen, und fragte dann, welches Vergehens man meinen Sohn eigentlich bezichtige? Nun ja, man habe ihn auf Bahnsteig ohne Fahr-karte angetroffen. Er wollte ja auch gar nicht mit den Zug fahren, entgegnete ich, und die früher einmal übliche Bahnsteigkarte, die zum Betreten des Geländes berechtig-te, wäre doch schon seit vielen Jahren abgeschafft. Man habe den Eindruck gewin-nen müssen, dass er doch einen Zug besteige wolle, logen sie nun, um den An-schein der Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens zu wahren. Natürlich kamen wir gegen soviel Willkür nicht an, also forderte ich meinen Sohn auf, die Strafgebühr zu zahlen. Draußen gab ich ihm den Zehner wieder, mit dringenden Hinweis, das nächste Mal pfiffiger zu sein und nicht wieder in eine Falle zu laufen.
Das war ein vergleichsweise harmloser Vorfall. Aber die Bekanntschaft mit der Staatssicherheit sollte noch intensiver werden. Eines Tages erschien unser Ältester bei uns mit einem Klassenkameraden, weil der dringend unseren Rat brauchte. Die beiden hatten sich nämlich entschieden, den Wehrdienst mit der Waffe zu verwei-gern, und schon trat das Prinzip Erpressung in Funktion. Der Schulfreund war zu ei-nem Gespräch bestellt worden - mit einem Kontaktmann der Stasi. Wenn er bereit sei, mit ihnen zusammenzuarbeiten, müsse er für seine Entscheidung keine Nachtei-le befürchten. Über das Gespräch dürfe er mit niemanden reden, auch nicht mit den Eltern. Da er mutmaßte, dass die Eltern aus Furcht, ihren Job zu verlieren, ihm mit Vorwürfen begegnen würden, suchte er in seiner Not das Gespräch mit anderen Menschen, die ihm vertrauenswürdig erschienen. Der Vorgang erschien uns ver-gleichbar einer Beichte, mit der sich ein gläubiger Katholik dem verschwiegenen Priester offenbart, um den seelischen Druck abzubauen. Und das brachte uns auf die Idee: Wir schickten ihn zu einem Pfarrer, der durch seine lebendige Jugendarbeit allgemein beliebt war und die beiden Jungen gut kannte, dem solle er sich anver-trauen. Danach könne er seinem Kontaktmann mitteilen, er habe die Gewissensnot nicht ertragen und dem Pfarrer als Mann seines Vertrauens den Fall vorgetragen. Die Sache funktionierte, der Stasimann brach den Kontakt ab.
Dieser Fall hat noch eine Pointe, über die man wirklich nicht lachen kann. Viele Jahre später nämlich, als es die DDR nicht mehr gab, stellte sich heraus, dass eben jener Pfarrer, dem er sich anvertraut hatte, selbst Mitarbeiter der Stasi gewesen war. Aber vielleicht war das ja sogar die ganz sichere Garantie dafür, dass dem jungen Mann keine Nachteile aus der Sache erwuchsen.
Die Behörde der Späher bestand ja nicht nur aus dem Fußvolk, das man auf den Straßen erlebte, grobschlächtigen Typen zumeist, die ihre Beobachtungen in den mitgeführten Regenschirm murmelten, wo das Mikrofon versteckt war. In den oberen Etagen des Ministeriums gab es Fachleute aller Couleur, auch Männer mit theologi-scher Bildung, wie mir Pfarrer Rainer Eppelmann, Bürgerrechtler und in der Regie-rung de Maizière später Minister für Abrüstung, seinerzeit bestätigte, nachdem er einige Tage 14 lang von der Staatssicherheit inhaftiert und vernommen worden war.
Diese Leute waren auch psychologisch durchaus geschult. Das erlebten wir bei der versuchten Anwerbung unseres Ältesten, der den Dienst mit der Waffe verweigerte und dafür seinen Wehrdienst als Bausoldat ableistete. Eines Tages tauchte er über-raschend zu einem Kurzurlaub in Berlin auf. Er habe hier einen Gesprächstermin. Wir ahnten nichts Gutes und befragten ihn dringlich. In seinem Einsatzort nahe der Ost-seeküste war er eines Tages zu einem Offizier in Zivil beordert worden, der ihm ei-nen anscheinend wohlgemeinten Vorschlag machte. Er wolle doch sicher auch, dass der Dienst geordnet ablaufe und es nicht durch Missverständnisse zu einem wie auch immer gearteten Aufbegehren käme. Da brauche man eben gebildete Leute, die Unstimmigkeiten sogleich erkennen, damit diese rechtzeitig beseitigt werden könnten. Es würde also zum Besten seiner Kameraden tätig sein und die Moral der Truppe festigen helfen. Wie soll ein Achtzehnjähriger auf solche wohlklingenden Ar-gumente reagieren?
Er brauchte dringend unseren Rat als Entscheidungshilfe. Wir fuhren ihn zu dem konspirativen Treffen mit dem Auto und zeigten uns demonstrativ auf der Straße, während wir auf seine Rückkehr warteten. Das entging natürlich den Verhandlungs-führern nicht. Als sich der Vorgang wiederholte, griffen sie zu härteren Methoden, setzten ihn physisch und psychisch unter Druck und erzwangen seine Unterschrift unter eine Bereitschaftserklärung. Nachdem er sich bei uns zu Hause geheult hatte, fuhren wir mit ihm zu einer uns befreundeten Superintendentin. Dort erleichterte er sein Gewissen, und sie riet ihm, seinem Verbindungsmann über das Gespräch zu berichten. Der reagierte mit dem knappen Hinweis: Vergessen Sie unsere Telefon-nummer! Unser Sohn wurde nie wieder von der Behörde behelligt. Nach dem Ab-sterben der DDR forderte er seine Stasi-Akte an: Der Ordner enthielt ein Blatt, das eine 24-stündige Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter mit Decknamen meldete; im üb-rigen war der Band mit Berichten über ihn und seine Ausspähung angefüllt.
Ob ich denn persönliche Nachteile durch die Staatssicherheit erfahren habe, hatte meine Kollegin mich damals gefragt? Falls sie diese Zeilen liest, mag sie selbst die Frage beantworten. Persönliche Nachteile? So direkt eigentlich nicht. Aber meine Erfahrungen mit der Spitzelbehörde reichten mir aus, um den Überwachungsstaat nicht gerade zu lieben.
*) Entnommen dem Buch:
Manfred Meier, Ein Leben in Deutschland, Erfahrungen mit zwei Diktaturen, Edition Steinbauer, Wien 2006 (ISBN 3-902 494 -11-5)
Mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlags