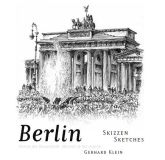Die Straßen von Berlin. Essay von Camilla Collett
Die norwegische Schriftstellerin Camilla Collett gilt als Vorreiterin der norwegischen Frauenbewegung. Als Tochter des Theologen und Politikers Nicolai Wergeland hatte sie 1813 das Licht der Welt erblickt und ihr wurde eine gute Ausbildung zuteil. Den Namen Collett nahm sie an, als sie 1841 den liberalen Juristen und Literaturkritiker Peter Jonas Collett heiratete. Ihr bekanntestes Werk ist der Roman „Amtmandens Dötre" (Die Töchter des Amtmanns). Ihr literarisches Vorbild war Rahel Varnhagen.
Immer wieder begab sie sich auf Auslandsreisen. Schon mit Anfang zwanzig lebte sie für ein Jahr in Hamburg. 1863 besuchte sie Berlin. Dazu entstand der Essay „Berlinske gader“, der hier in der Übersetzung von Nadine Erler und in Auszügen zu lesen ist.
Berlin, 24. Oktober 1863
Es bürgert sich immer mehr ein, dass Norweger, die auf Reisen sind, mit ihrer Heimat korrespondieren. Wenn man so dasitzt, kann man kaum verstehen, dass Leute, auf die plötzlich so viel Neues einstürmt, Zeit und Ruhe für oft lange und gründliche Abhandlungen finden. Schwärmen, sammeln, das kommt von selbst, aber die Bearbeitung muss man sich für die langen, stillen Tage zu Hause aufheben. Wenn man selbst ins Ausland kommt, begreift man es. […]
Beim Erleben der neue Eindrücke werden wir uns unserer Art erst richtig bewusst. Mutter Norwegen weiß, was sie tut, wenn sie ihre Kinder weit weg und zu so gefährlichen Tummelplätzen schickt, sie kennt ihre Macht. Wir spüren alle gleichsam ein unsichtbares Band am Bein, an dem gezogen wird, sobald wir nach etwas greifen, das keine Verbindung mit der Heimat hat. Erleben wir eine Freude, die das Heimatland uns nicht bieten kann, müssen wir daran denken – und an die Leute, die sie nicht mit uns teilen können. Man kauft kein Band, keine Weste, keine Krawatte oder etwas dergleichen, ohne dabei an die Carl Johans Gade oder den Schlosspark zu denken, kein Bild, das man nicht schon in einem dankbaren, vergnügten Kreis am eigenen Tisch zirkulieren sieht. Wenn man einen plötzlichen Einfall hat – man sieht nicht einmal, ob er richtig reif ist oder nur „auf einer Seite rot“ – , es wundert doch niemanden hier. Und so kommt es nur wenig darauf an, was und wie viel wir erleben – in Hülle und Fülle oder so gut wie gar nichts – es muss nach Hause. Wir gleichen Kindern, die sich auf der Wiese keine einzige Beere gönnen, sondern sie mit zur Mutter nach Hause bringen. Aber dann kommt es eben auch vor, dass Mutter nicht die warmen Dankesworte sagt, die wir erwartet haben, sondern: „Das ist nichts weiter, Kind, iss es selbst!“
[…]
Wenn der Leser – verwöhnt, wie er ist – gründliche und vielseitige Erklärungen erwartet, sei es in Bezug auf Statistik, Belletristik, Geographie, Topografie, Geschichte oder Kulturgeschichte, so wird er enttäuscht. Die Korrespondentin zeigt eine geradezu gefühllose Gleichgültigkeit für Fragen wie die, warum Berlin ausgerechnet an einer Stelle mitten im Brandenburger Sand errichtet wurde, warum es überhaupt gebaut wurde und von wem es gebaut wurde – wenn nur nicht so viel von diesem Sand auf den Straßen wäre und einem nicht ständig in die Augen fliegen würde! – und dieser Mangel an Wissenschaftlichkeit dehnt sich bedauerlicherweise auf alle Bereiche aus.
Wenn die Behauptung stimmt, dass man mit wachsender Gelehrsamkeit immer mehr merkt, dass man so gut wie nichts weiß, hätte ich schon 1830 auf dem Niveau meiner Schulbildung mit dem zufrieden sein können, was ich damals wusste. Ich habe es seither nicht für nötig befunden, das Stadium zu erreichen, indem man die Entdeckung macht, dass man nichts weiß. Was ich berichten kann, beschränkt sich für den Augenblick auf einige Beobachtungen, die angestellt habe, als ich auf dem Weg in das Zentrum der Stadt war: Unter den Linden.
Der Weg ist lang – das heißt, der zum Museum. Wenn man es eilig hat oder müde ist, steigt man in einen Omnibus; es fährt alle fünf Minuten einer. Omnibus zu fahren, ist nicht vornehm – sollte man meinen, aber auch das gehört zu den Ansichten, die man ablegen muss, wenn man ins Ausland fährt. Wer reisen will, muss einige seiner vornehmen Gewohnheiten zu Hause lassen. Zu Hause ist es leicht, Aristokrat zu sein, denn dort kostet es nichts, man muss ja nur stillsitzen und sich langweilen – das ist aristokratisch. Auf Reisen ist es dagegen sehr teuer; also fährt man Omnibus, das ist billig und oft sehr amüsant. Man wird immer höflich behandelt. Überhaupt scheinen die Deutschen, wenn man sie nach den Berlinern beurteilt, ein artiges und höfliches Volk zu sein, jedenfalls im flüchtigen „Verkehr“ mit ihnen. […]
Omnibus zu fahren, ist sehr unterhaltsam. Wo kann man besser in aller Ruhe die Physiognomie der Bevölkerung und ihre – aber nicht allzu hastig – wechselnde Vielfalt studieren? Man fühlt sich all diesen Gestalten, die ein- und aussteigen, geradezu verpflichtet, man will ihnen danken, als würden sie alles nur für uns tun. Solche ausgeprägten Vertreter der verschiedensten Schichten, Vorhaben, Eigenheiten – aber alle trugen ein bestimmtes unsichtbares Kennzeichen: das Deutschsein. Wenn ein Engländer oder Südländer einsteigt, merkt man es sofort.
[…] Die Gesellschaft in einem solchen Bus gibt einem Fremden oft das Gefühl, er sei in einen Kreis guter Freunde hineingeraten, die sich zu einem vergnüglichen Ausflug versammelt haben. Man schämt sich beinahe dafür, dass man so steif und still dasitzt.
[…] Wie würden wir uns zu Hause in einem Omnibus verhalten? Vielleicht wie ein Transport von Sträflingen, die einander in stummem Misstrauen beäugen? In den deutschen Omnibussen geht es nicht ganz so herzlich zu wie in den dänischen, sondern ernster und formeller. Aber auch hier fehlt es nicht an lustigen Szenen, besonders, wenn kleine Kinder dabei sind, die immer ihr Vorrecht geltend machen, Gespräche anzuknüpfen und in Gang zu halten.
Gestern war also eine junge, hübsche Bürgersfrau dabei, die ein prächtiges Exemplar von einem Jungen (zwei oder drei Jahre alt) auf dem Schoß hatte. Er aß, so viel er konnte, aus einer riesigen Tüte Weintraube, die seine Mutter ihm auf keine Weise wegnehmen konnte. Er zerknüllte die Tüte, dass es nur so raschelte, und jubilierte dazu wie ein fröhlicher kleiner Bacchus. Hübsch war er auch, er hätte also ein gutes Modell für einen solchen abgegeben. Ich sah nach, ob ein Künstler zugegen war. Je mehr die anderen lachten, desto vergnügter wurde er, und die Mutter war glückselig. So ein Batzen Glückseligkeit ist eine Menge für einen Silbergroschen – etwa zweieinhalb norwegische Schilling. Neulich, als die Reisegesellschaft ungewohnt vornehm war, stieg eine Marktfrau mit ihrem Korb und ihrem Feuerbecken ein. „Aber liebe Madame, das Feuerbecken soll doch wohl nicht mitgehen?“ sagte ein älterer Herr, der aussah wie ein Literat. „Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren heute“, antwortete sie und ließ sich mit dem Feuerbecken unter dem Rock nieder. Der dünne kleine Mann rückte zur Seite, soweit es ging. „Ach, Sie brauchen nicht so weit zu rücken, Sie sehen jar nicht danach aus, so leicht Feuer zu fangen.“ Eine ältere, vornehm gekleidete Frau gegenüber mischte sich ein und sagte: „Meine liebe Madame, mit Ihren Sachen dort dürften Sie eigentlich nicht im Omnibus gehen. Sie nehmen zu viel Platz auf.“ „Meine liebe Dame“, antwortete die Madame, „mit einer solchen Krinoline sollte man auch nicht im Omnibus jehen, er nimmt jar zu viel Platz auf.“ Auf diese Antwort folgte eine verblüffte Stille und der Friede schien – wenn auch nicht auf diplomatische Weise – wiederhergestellt. Aber damit war die Szene noch nicht zu Ende. Sie zog eine Schürze heraus, aus der sie etwas hervorkramte. Es war unmöglich zu erraten, was es war – eine feuchte Substanz, die sie eifrig knetete und zu kleinen Kügelchen formte. Die Anwesenden, die neugierig darauf waren, wozu das gut sein sollte, blieben nicht lange im Zweifel. Sie nahm ein lebendes Huhn aus ihrem Korb und fütterte es mit einer Ungeniertheit und völliger Gemütsruhe, als sei sie zu Hause. Das Huhn verhielt sich mustergültig – was wohl passiert wäre, wenn es auch angefangen hätte, Beispiele für Berliner Schlagfertigkeit zu geben, kann man sich nicht vorstellen.
Der Busfahrer nimmt immer regen Anteil an allem, was im Bus vorgeht. Der kleine Raum ist sein Wohnzimmer, die Passagiere seine Familie und seine Kinder; er amüsiert sich über sie, beurteiltsie und erfüllt ihre Wünsche, so gut es geht. Die Fürsorglichkeit, mit der er Damen und Kindern hinauf- und hinunterhilft, ist richtig rührend. Dieser ständige „Verkehr“ mit Menschen macht ihn gesellig und zuvorkommend, er scheint immer guter Laune zu sein. Der Omnibusfahrer ist der Gegensatz zum Droschkenkutscher, der menschenfeindlich und gutmütig-brutal aussieht. Gewisse Eigenschaften verleugnen sich bei einem Deutschen nie – ich bin sicher, dass auch Priess* sentimental ist.
[…]
30. Oktober
Die Berliner haben den Ruf, ein witzig-geistreicher, raffinierter, aber kaltherziger Menschenschlag zu sein. Ich kenne die eigentliche Gesellschaft, die diese Beschuldigung wohl am ehesten trifft, zu wenig, um zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Der Eindruck, den man von den Berlinern im Allgemeinen bekommt, bestätigt dieses Urteil nicht. Vielmehr haben sie eine vertrauenerweckende, spießbürgerliche Bonhommie an sich, die auf Norweger bei einem längeren Aufenthalt hier wirkt wie eine Molkekur. „Nette Leute“ kann man sie auch nennen, denn unter hundert Individuen gibt es kaum einen Grobian. Sie begegnen der Unbeholfenheit eines Fremden mit einer gewissen gutmütigen Herablassung; um einem Fremden den Weg zu zeigen, wenn er die Orientierung verloren hat, legen sie gern lange Strecken zurück. Die Art eines Volkes kann man am besten beurteilen, wenn man es an Orten beobachtet, an denen viele Menschen sind – z. B. vorbestimmten Läden, besonders denen der Fotografen, am Ein- und Ausgang von Theatern, Museen etc. Vor allem das Verhalten der Männer gegenüber den Damen ist sehr erhellend. Und hier haben wir nie etwas erfahren oder gesehen, das auch nur das empfindlichste Gemüt hätte verletzen können.Überall scheint jeder nur mit sich selbst beschäftigt zu sein, aber nicht, ohne die Rechte des Nächsten zu achten. Dank dieser offenkundigen Wohlerzogenheit macht man Bekanntschaft mit einer Besonderheit. Auch wenn der Platz nicht der bequemste ist, kann man nicht umhin, eine Beobachtung zu machen – nämlich die, dass Damen allein durch die Straßen gehen können, auch noch ziemlich spät, ohne angesprochen zu werden oder sich irgendwelchen Aufdringlichkeiten auszusetzen. Ich bewundere diese Freiheit, ohne dass ich bisher selbst gewagt hätte, Gebrauch davon zu machen. Aber hier gehen alle allein – es ergibt sich ganz von selbst,und man muss sich Berlins breite, prächtige Straßen vorstellen, hell wie am Tag. Das ist mehr, als man von den beiden größeren skandinavischen Hauptstädten sagen kann – und leider auch von unserem eigenen kleinen Parvenu, der sich auch schon die Hochnäsigkeit dieser beiden großen Städte angeeignet hat.
[…]
Berlin sieht man am besten zum ersten Mal, kurz nachdem es geregnet hat. Bei trockenem Wetter liegt der Staub – die ärgste Geißel der Berliner – wie eine Wolke über den stark befahrenen Straßen. Es war ein klarer Oktobertag, und wir befanden uns Unter den Linden, der berühmten Promenade. Es war kurz vor Sonnenuntergang, gegenüber vom Brandenburger Tor, und die letzten Strahlen fielen auf die breite Straße. In diesem grellen, staubigen Licht und in sommerlicher Wärme sahen „die Linden“ mit ihren alten, morschen Stämmen und den wenigen halbverwelkten Blättern recht traurig aus. Sie schienen – selbst lebenssatt und blasiert – auf die künstliche, blasierte Welt hinabzuschauen, für die sie so viele lange Jahre „Natur“ gespielt hatten. Jetzt hatten sie keine Lust mehr. Sie wollten überhaupt nicht mehr grün werden. Unter den Linden sieht man das Kaffeehaus- und Müßiggängerleben von seiner vornehmsten Seite. Drinnen kann man sehen, wie der Geschäftsmann eine kurze Verschnaufpause zwischen dem Büro und dem trauten Heim sucht. Man erkennt ihn an der Eile, mit der er die Zeitung und sein Glas Toddy verschlingt. Draußen vor den Türen sitzen in schwarzen, unbeweglichen Gruppen – wie Fliegen am Spundloch eines Bierfasses – die Eleganten, die Müßiggänger ex professo, diese Arbeiter im Weingarten der Zeit, die weder Atempausen noch Unterbrechungen kennen, weder Büro noch trautes Heim. In stummer Ruhe rauchen sie ihre Abendzigarre und beobachten die Passanten.
Und so wechseln sich Kaffeehäuser und Läden ab, bis man zur Schlossbrücke mit ihren weißen Marmorstatuen kommt.Um diesen Punkt schart sich eine Menge prächtiger Bauwerke – königliche Paläste, die Universität, das Opernhaus, das Alte Schloss, der Dom, das Museum. Es ist eine wahrhaft großartige Versammlung, die sich bei einer schönen Beleuchtung und wenn die Linden sich entschließen könnten, wieder grün zu werden, wirklich gut machen würde.
Und das Museum! Ja, das Museum! Keine Angst, ich erzähle nichts vom Museum. Auch nicht von der Oper. Ich kenne die Art von Beschreibung, sie klingen beinahe, als ob man von einem Hungernden verlangen würde, sich mit der Menükarte zu begnügen statt mit den Gerichten. Lass mich nur sagen, dass derjenige, der das Museum auf die Art besuchen will, wie es Reisende im allgemeinen tun – das heißt: kopflos hindurchjagen –, am besten handelt, wenn er nicht hingeht.
* Friedrich Wilhelm Priess (1834–1864):Ein wegen Raubmordes in Norwegen hingerichteter Deutscher (Anm. d. Ü.).